Die Vegetation ist nicht nur dicht, sie ist beinahe undurchdringlich. Und dieses Wort bekommt hier eine neue Bedeutung. Mit Macheten bahnen wir uns unseren Weg, und alle paar Meter gibt der „Boden“ unter mir nach – denn ich gehe selten auf festem Grund, sondern meist auf einer dicken Schicht umgeknickten Pflanzenmaterials. Wir kommen nur sehr langsam voran, und ständig wische ich Spinnennetze aus meinem Gesicht. Wenn ich anderswo in Afrika zu Fuß unterwegs bin, achte ich genau auf Schlangen und Skorpione – das erscheint mir hier geradezu lächerlich. Immerhin versuche ich immer wieder, meine Hosenbeine gut unter den Socken zu verpacken, um das Eindringen der allgegenwärtigen Ameisen zu verhindern. Üppiger tropischer Bergregenwald bedeckt die Berge im Grenzgebiet von Ruanda, Uganda und der demokratischen Republik Kongo, Urwaldrieen ragen himmelhoch auf.





Der Virunga-Nationalpark, der Ruwenzori, der Bwingi-Park, die Mondberge – verschiedene Namen für das gleiche, relativ kleine Gebiet rund um die Vulkane Karasimbi und Visoke. Es ist feucht, aber immerhin nicht heiß, denn die Vulkane sind 4000 Meter hoch. Allerdings sind sie steil und unwegsam, und der Aufstieg erfordert eine gewisse Kondition. Dies ist das Land, in dem Dian Fossey ihre legendären Forschungen unternommen und gleichzeitig gegen Wilderer, Regierungsbeamte und die Nationalparkbehörde gekämpft hat, mit viel Idealismus und Herzblut und wenig Sinn für Diplomatie. Es ist der Lebensraum der Berggorillas. Noch etwa 1000 Tiere leben in dem Nebelwald, und die Population war in den letzen Jahren einigermaßen stabil. Doch die Zerstörung des Lebensraumes ist nach wie vor ein Problem -die Teeplantagen des überbevölkerten Ruanda reichen bis an die unmittelbare Grenze des Nationalparks- und auch der Wilderei fallen nach wie vor Gorillas zum Opfer. Rund 10 Jahre vor meinem ersten Besuch in den Bergen war Ruanda Schauplatz eines grausamen Bürgerkrieges und Völkermordes, bei dem innerhalb weniger Wochen eine Million Menschen massakriert wurden – vor den Augen untätiger französischer Soldaten. Der jetzige Präsident Paul Kagame marschierte an der Spitze einer Rebellenarmee in Ruanda ein, stellte die Ordnung wieder her und regiert das Land seither mit harter Hand. Er ist sicher nicht zimperlich, aber Ruanda ist heute eine afrikanische Vorzeigenation – blitzsauber, aufgeräumt, ordentlich und wesentlich entwickelter als alle seine Nachbarländer. Wer Afrika kennt und seine Hinterhöfe gesehen hat, der kann ermessen, wie groß der Unterschied ist im Zustand des Landes und in den Köpfen der Menschen. Es herrscht also wieder Ruhe in Ruanda, und der Bürgerkrieg ist vorbei, aber in den Wäldern und Bergen im Grenzgebiet zum Kongo marodieren noch tausende bewaffnete Männer – Soldaten, Flüchtlinge und Wilderer, wobei ein und dieselbe Person alle diese Attribute tragen kann. Sie ernähren sich nicht selten von „Bushmeat“ – und das ist eine große Gefahr für die Gorillas.










Als ich meiner ersten Gruppe von Berggorillas gegenüberstehe, weiß ich sofort dass es die faszinierendsten Geschöpfe sind, die ich jemals gesehen habe. Ich muss nur einmal in die Augen eines Gorillas blicken, um diese Erinnerung für immer mit mir zu tragen. Die Tiere -es widerstrebt mir fast, sie so zu nennen, denn sie wirken wie Menschen- sitzen auf einer kleinen Lichtung und fressen wilde Sellerie und andere Pflanzen. Sie lausen sich gegenseitig, Mütter stillen ihre Babies, Jungtiere spielen, der Silberrücken sitzt etwas abseits entspannt da, aber er beobachtet die Szene sehr aufmerksam. Als er sich schließlich sicher ist, dass von uns keine Gefahr ausgeht, legt er sich gemütlich in die Sonne und verschränkt die Arme hinter dem Kopf. Zum Schutz der Gorillas vor Infektionskrankheiten sind wir angehalten, einige Meter Abstand zu halten, aber den Jungtieren ist das egal. Sie kommen auf unmittelbare Nähe heran, fordern mich zum Spielen auf, berühren meine Hand und wären mir wohl auf den Schoß geklettert, hätte ich mich nicht vorsichtig zurückgezogen. Die Stunde, die Besuchern bei den Tieren zugestanden wird, ist im Handumdrehen vergangen, und auch am nächsten Tag ist die Zeit viel zu kurz. Das Erlebnis jedoch, Auge in Auge mit den Berggorillas zu sein und, wenn auch nur kurz, an ihrem Familienleben teilhaben zu dürfen, ist unvergesslich.










Einige Tage später bin ich auf der anderen Seite der Grenze, in der demokratischen Republik Kongo. Hier ist man einem Bürgerkrieg noch um einiges näher als in Ruanda, und das merkt man auf Schritt und Tritt. Die Schilderung des Grenzübertritts würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen, die Straßen sind praktisch unbefahrbar, dafür gibt es alle paar hundert Meter Stellungen mit Sandsäcken, Maschinengewehren und ein paar zerlumpten Gestalten, die bestenfalls Teile von Uniformen tragen. Es ist nie ganz klar, ob es sich um Polizei, um Armee, um Rebellen oder um Banditen handelt. Klar ist aber jedes Mal die Forderung nach Schmiergeld.










Ich treffe keine Weißen, und im Kahuzi-Biega-Nationalpark gab es in den letzten beiden Monaten keine Besucher. Dafür ist eine Gruppe von zwanzig UNO-Soldaten vor Ort, und mir wird erst nach einiger Zeit klar, dass sie unseretwegen gekommen sind. Der Park selbst ist ebenfalls militärisch organisiert, und mit starker bewaffneter Eskorte begeben wir uns hier auf die Suche nach östlichen Flachlandgorillas. Diese sind weit weniger habituiert, und also scheuer als die Berggorillas in Ruanda, aber nicht weniger faszinierend. Auch hier fällt es mir wieder schwer, mich von dem Anblick der Tiere zu lösen. Sie benötigen allen Schutz, den sie bekommen können. Und sie benötigen Frieden und stabile staatliche Strukturen in der Region, denn das wäre nicht nur ein lange überfälliger Segen für die Menschen, sondern auch der beste Schutz gegen Wilderer. Wer den Osten der demokratischen Republik Kongo bereist hat – ein Land, in dem praktisch keine staatliche Autorität besteht – der hat eine Ahnung davon, wie weit der Weg dorthin ist.
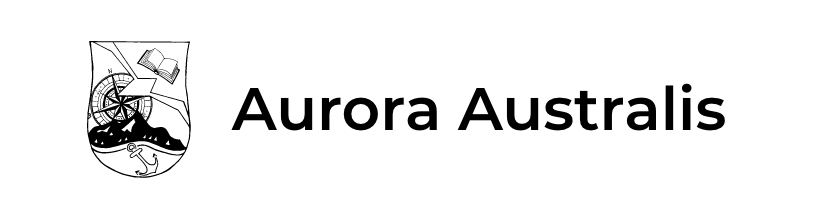
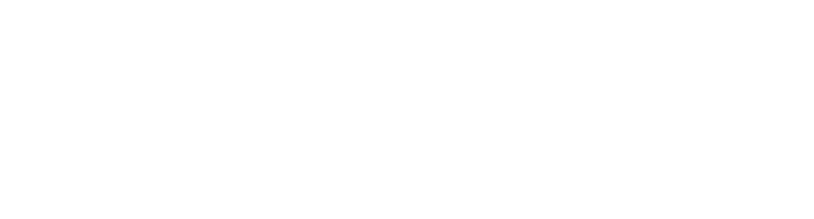
0 Thoughts on Gorillas im Nebel