Ich sitze in Jane Goodalls Wohnzimmer und lausche ehrfurchtsvoll den Geschichten aus den Anfängen der Primatenforschung, aus der Zeit, in der die junge Britin mit wenig Erfahrung und viel Idealismus ins tiefste Afrika reiste, um dort mit Schimpansen zu arbeiten. Die Einrichtung ist spartanisch, die Atmosphäre faszinierend. Abends gehe ich die paar Schritte zum Ufer des Tanganjikasees. Der Gombe Nationalpark liegt ganz im Westen von Tansania, ist nur durch einen Flug in einem Kleinflugzeug nach Kigoma und eine anschließende mehrstündige Bootsfahrt sinnvoll zu erreichen und entsprechend wenig besucht. Der Tanganjikasee ist sehr lang, sehr tief und relativ schmal – im Westen, bei Sonnenuntergang, sind schemenhaft die Hügel des Kongo zu erkennen. Er ist Teil des ostafrikanischen Grabenbruchs, einer geologisch jungen Bruchlinie des afrikanischen Kontinents, und vor allem: einem der wirklichen Hotspots der Biodiversität.








Die paar Besucher, die jährlich in den Gombe Nationalpark kommen, haben dafür nur einen Grund: die Schimpansen -neben den Bonobos unsere nächsten Verwandten-, die im Westen Tansanias wahrscheinlich besser als irgendwo sonst beobachtet werden können. Durch die jahrzehntelange wissenschaftliche Erforschung sind die Tiere dort so weit an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt, dass man dort als Naturfotograf hervorragende Bedingungen vorfindet.




Dennoch können Schimpansentrackings sehr unterschiedlich aussehen, wie ich bei zwei Besuchen im Gombe im Abstand von einigen Jahren – und zu verschiedenen Jahreszeiten – erleben darf. Bei meinem ersten Besuch renne ich stundenlang durch weg- und pfadlosen Dschungel, überquere Bäche und klettere über Felsen, immer so schnell wie möglich, um einer hochmobilen Schimpansengruppe zu folgen. Durchgeschwitzt und dreckverkrustet bekomme ich die Tiere nur in kurzen Momenten zu Gesicht, und die guten Momente für Fotos sind dünn gesät. Ganz anders ist es bei meiner zweiten Tour in den Gombe Park: die Schimpansen halten sich in unmittelbarer Nähe auf, sie sitzen entspannt auf kleinen Lichtungen und lassen mich als Gast an ihrem Familienleben teilhaben.



Sie begrüßen sich, sie lausen einander, sie trinken aus einem Bächlein, sie stillen ihre Babies, sie stochern mit Zweigen in einem Termitenbau – die Beobachtung, dass kulturell tradierter Werkzeuggebrauch nicht auf die menschliche Spezies beschränkt ist, schlug einst wie eine Bombe in der wissenschaftlichen Welt ein. Die Jungtiere spielen, sie baumeln an Lianen und präsentieren sich den Besuchern, die sie zum Mitmachen auffordern.


Schimpansen haben komplexe soziale Hierarchien, sie schmieden Koalitionen und Freundschaften, sie teilen kulturelle Errungenschaften, sie gehen gemeinsam auf die Jagd, sie patrouillieren in ihrem Territorium, sie führen mitunter sogar Kriege gegen benachbarte Gruppen, die in Einzelfällen bis zur praktischen Auslöschung der Verlierer gehen können. Die Schimpansen sind uns Menschen so ähnlich wie es ohne einer komplex entwickelten Sprache überhaupt nur möglich ist. Das ist keine abstrakte wissenschaftliche Erkenntnis, sondern diese enge Verwandtschaft ist für jeden evident, der ein paar Stunden Zeit mit frei lebenden Schimpansen verbringen darf.



Ich hatte das riesige Privileg, vier der fünf Menschenaffen -Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und Gibbons- in freier Natur beobachten und fotografieren zu dürfen (bei der fünften Art, dem Bonobo, ist mir keine qualitativ gute Besuchsmöglichkeit bekannt). Jede dieser Touren war einmalig, faszinierend, grandios und unvergesslich. Jede Begegnung war einzigartig; aber bei den Schimpansen hatte ich mehr als jemals sonst das Gefühl, zu Gast bei nahen Verwandten zu sein.
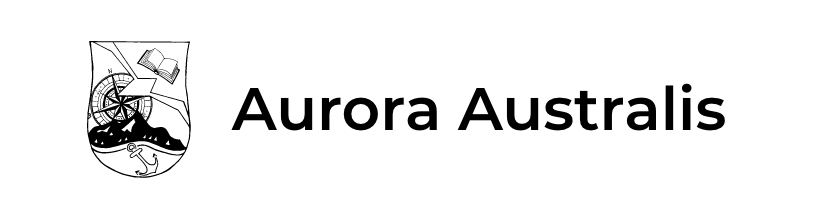
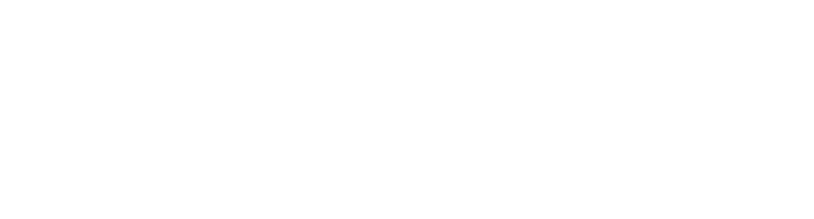
0 Thoughts on Verwandtenbesuch